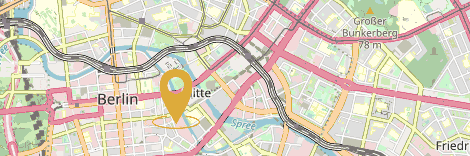Krise als Auftrag: Der Jazz-thing-Lockdown-Roundtable, Teil 2
[4.5.2020]
Nachdem die Beteiligten unseres Roundtables im ersten Teil des Gesprächs ihre Erfahrungen mit dem Lockdown geschildert haben, geht es im zweiten Teil um die Frage der gesellschaftlichen Folgen und der Konsequenzen für die Jazz-, Musik- und Kunstszene allgemein.
Abgesehen von den unmittelbaren Folgen für Künstler und Kulturschaffende ist die Kultur aus dem öffentlichen Raum nahezu komplett verschwunden. Wie lange, denkt ihr, hält die Gesellschaft es überhaupt ohne Kultur aus?
Steffen Wilde: Nicht mehr lange. Alle vermissen das jetzt schon so wahnsinnig.
Martin Laurentius: Ich glaube, dass alles, was jetzt verboten ist, also die ganzen Kulturveranstaltungen von Konzerten über Museen und Ausstellungen bis hin zum Fußball, das Leben erst lebenswert machen. Man kommt in direkten Kontakt mit Menschen, tauscht sich aus, freut und ärgert sich gemeinsam. All das fehlt jetzt. Der Unmut über die Situation an sich verstärkt sich durch das Fehlen dieser Gelegenheiten. Man kann und darf nicht mehr so leben, wie man das gerade noch durfte. Ich sehe durchaus die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ein, trotzdem wächst auch bei mir der Unmut darüber, dass draußen das Wetter schön ist und ich mit meinen Kindern nur begrenzt rausgehen kann.
Stefanie Marcus: Was du beschreibst, betrifft ja nicht den Kulturverlust der Gesellschaft. Man muss unterscheiden, was wir an Kultur vermissen und was wir an Begegnung vermissen. Was fehlt uns unabhängig von den Notlagen bei Künstlern, Veranstaltern und anderen Beteiligten wirklich? Fehlt uns das Konzert, oder fehlt uns das Biertrinken?
Steffen Wilde: Bei einem Konzert hast du ja beides. Es gibt Live-Musik, und die Menschen können sich begegnen. Gerade diese Kombination ist ein großer Wert, der nicht zu ersetzen ist. Das ganze Streaming ist schön, weil es nach wie vor Musik gibt, aber nichts kann die Begegnungssituation ersetzen. Wir können uns alle zu Hause einschließen und gesund bleiben – das ist super –, aber was uns dadurch fehlt, sind der Kontakt und Austausch vor Ort, egal ob im Biergarten, Konzert oder Theater.
Julia Hülsmann: Wie definiert sich denn eine Gesellschaft? Die Kultur, die in einer Gesellschaft entsteht, ist genauso wichtig wie alles andere. Was wir jetzt erleben, funktioniert wie ein Pausenschalter, und das ist gefährlich.
Nils Wogram: Es gibt ja die These, dass in dieser Situation eine größere Wertschätzung von Kultur einsetzt, weil sie eben nicht da ist. Nach dem Lockdown freuen sich dann alle wahnsinnig und gehen wieder los, um Kultur zu genießen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das nicht eintritt. Man kommt in so eine Art Gewohnheitszustand. Das merkt man ja schon bei den Begrüßungen. Gerade noch hat man Menschen mit Umarmung oder Handschlag begrüßt, und plötzlich ist es normal, das nicht mehr zu tun. Man hat sich daran gewöhnt. Ich befürchte, dass die Menschen nach Beendigung des Lockdowns immer noch Angst haben und obendrein in eine Art Lähmung geraten sind, die sie eben nicht in die Kultur zurückströmen lässt. Ich hoffe, ich irre mich.
Ist die Jazzszene denn anders betroffen als beispielsweise Pop, Theater, Klassik oder die bildende Kunst?
Norbert Oberhaus: Ich kann ja nur für die Popszene sprechen, aber am Ende des Tages ist die ökonomische und soziale Komponente überall recht ähnlich. Egal, ob du ein Festival oder einen Club betreibst, du musst alles absagen, hast null Einnahmen und weißt nicht, wann es weitergeht. Viele Künstlerinnen und Künstler haben überhaupt keine Rücklagen.
Martin Laurentius: Ich weiß nicht, ob die Jazzszene anders betroffen ist, aber sie geht zumindest anders mit der Situation um. Die Pop- und Rockmusik ist uns ein Stück voraus in Sachen Selbstorganisation und Netzwerk. Man kann von Streaming-Konzerten halten, was man will, aber da gibt es eben Plattformen, auf denen diese Konzerte auf nationaler und internationaler Ebene gebündelt angeboten werden. Vielleicht ist es ja auch die Aufgabe der Popmusik, den Zeitgeist einzufangen und für andere erlebbar zu machen. Anders als das bei einer etwas komplexeren Musikform wie dem Jazz der Fall ist. Aber die Verlautbarungen der Deutschen Jazz Union machen mir deutlich, dass in dieser Krise Instrumentarien wie Pressemitteilungen eben nicht reichen. Wir alle sitzen zu Hause und können nichts tun. Es ist unmöglich geworden, sich hinter einer Fahne zu versammeln und mit lauter Stimme zu sprechen. Die Verlautbarungen sind notwendig, um sich Gehör zu verschaffen, aber das Ergebnis ist sicher ein anderes, als es vor Corona der Fall gewesen wäre. Und auf digitalem Wege haben wir noch nicht die adäquaten Mittel, um das zu ersetzen.
Nils Wogram: Der Jazz unterscheidet sich insofern von anderen Musikrichtungen, als dass die Interaktion essenziell ist. Das passiert ja live. Man reagiert aufeinander. Im Moment ist das nicht möglich. Die Lebendigkeit, die beim Zusammenspiel entsteht, ist beim Jazz viel mehr gefordert als bei anderen Musikrichtungen. Wirtschaftlich gesehen ist es wahrscheinlich für alle gleich. Im Jazz gibt es allerdings schon noch sehr viele Musiker, die ausschließlich vom Spielen ihres Instruments leben und jetzt große Probleme haben. Bei 90 Prozent der klassischen Musiker ist das nicht der Fall. Die haben ihre Unterrichtsjobs und gehen gar nicht davon aus, dass das Live-Spiel ein substanzieller Beitrag zum Lebensunterhalt ist.
Stefanie Marcus: Ich bin sicher, dass das nicht stimmt. Wenn man in die Alte Musik oder die Kammermusik schaut, stellt sich die Situation genauso dar. Es gibt auch andere Kunstformen, die auf Interaktion basieren wie den Theater- oder Tanzbereich. Alle Jazzmusiker wären gut beraten, das als Gesamtsituation zu betrachten und sich nicht als Einzelgruppe zu separieren. Beim Jazz handelt es sich um eine sehr kleine Gruppe. Um der Dringlichkeit der Abhilfe dieser Notlage Ausdruck zu verleihen, fände ich es sehr sinnvoll, wenn die Künstler sich über ihre Genres hinaus solidarisieren.
Gerade in Berlin haben wir ja auch eine ohnehin schon darbende Techno-Clubszene. Auch Techno lebt von der Interaktion zwischen DJ und Tanzenden. Den Jazzclubs geht es ja nicht anders als Techno-Buden, Rockschuppen, Galerien und Off-Theatern. Man wäre doch viel stärker, wenn man die Grabenkämpfe beenden, sich solidarisieren und die Kräfte bündeln würde. Kann man Kultur nicht mal wieder etwas größer denken?
Norbert Oberhaus: Es gibt Bereiche im Pop, die sehr gut organisiert sind. Das betrifft vor allem die Clubs. In Hamburg, Köln und Berlin gibt es seit Jahren regionale Verbände, die in diesem Fall auch die ersten waren, die sich für zusätzliche Mittel stark machen konnten. Für die Musikerinnen und Musiker selbst gibt es überhaupt keine Organisationen. Daran mangelt es. Viele der Soforthilfeprogramme greifen für sie überhaupt nicht. Es ist ja genug Geld da, aber man muss auch wissen, wo man es abholen kann. Im Augenblick gibt es einen Verteilungskampf. Wer am lautesten brüllt und in Berlin vorstellig wird, holt auch das Geld ab. Das zeigt, dass man organisiert sein muss. Was wichtig ist oder nicht, interessiert Politiker leider überhaupt nicht. Es kommt darauf an, darum zu kämpfen.
Julia Hülsmann: Ich fand schon immer, dass man das so groß wie möglich denken soll. Am liebsten wäre mir keine Deutsche Jazz Union, sondern eine Deutsche Musik Union. Ich will trotzdem eine Lanze für die Deutsche Jazz Union brechen, die ich ja wieder mit angeschoben habe. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Es braucht Menschen, die diese Arbeit machen, und es müssen Strukturen geschaffen werden. Und man braucht eine Idee, was man will, mit wem man sich zusammentun kann oder wo sich Dinge unterscheiden. Für diese Arbeit gibt es nicht so viele, die das Know-how haben und die Lust, sich mir den Strukturen auseinanderzusetzen, denen man in der Kulturpolitik gegenübersteht. Ich habe mich mit diesen Dingen beschäftigt, aber ich bin Musikerin und keine Kulturpolitikerin. Das müssen Menschen machen, die das können.
Stefanie Marcus: Es gibt sicher Menschen, die das wollen. Das Problem liegt aber noch ein Stück darunter. Die Solidarisierung der Musiker ist im Jazzbereich vorhanden, aber im Pop gibt es das unter den Musikern in dieser Form nicht.
Norbert Oberhaus: Das stimmt.
Stefanie Marcus: Das wäre zur Zeit sehr hilfreich, denn dann hätte man ganz andere Power, um Forderungen zu formulieren. Dieses Manko liegt seit 15 Jahren auf dem Tisch. Aber das kann man jetzt nicht aus dem Boden stampfen. Das Bewusstsein muss geschaffen werden, und dann müssen sich die Musiker das auch über Mitgliedsbeiträge was kosten lassen. Dann kann man auch entsprechend kompetente Leute in die Position setzen, um mit der Politik zu verhandeln. In Berlin kann man im Kleinen nachvollziehen, dass dieser Weg zu einem relativ guten Ergebnis geführt hat. Die Wege sind kurz, die Probleme sind bekannt, und die Bereitschaft zu helfen ist wirklich groß.
Martin Laurentius: Dann kann man es ja in der Krise als Auftrag sehen, Strukturen zu schaffen, die nicht nur für die eigene Szene wichtig sind, sondern eben auch darüber hinaus. Es kommt jetzt darauf an, Kontakte zur Pop-, Rock-, Kammermusik-, Neue Musik- und jeder nur denkbaren Szene zu suchen. Es geht nicht, dass wir weiterhin alle in unserer jeweiligen Community verhaftet bleiben.
Stefanie Marcus: Im Grunde bräuchten wir die Gewerkschaft. Alle Musiker, überhaupt alle Soloselbständigen sollten die Gewerkschaft wahrnehmen. Das ist so wahnsinnig unmodern geworden, aber es wäre gut.
Julia Hülsmann: Ich selbst bin Verdi-Mitglied und kenne immer mehr Musikerinnen und Musiker, bei denen ein Bewusstsein dafür einsetzt. Wenn die Gruppe der Musiker in so einer Gewerkschaft immer größer wird, dann müssen die ja auch irgendwann einsehen, dass die dafür etwas tun müssen.
Steffen Wilde: Dass dieser Schulterschluss funktionieren kann, hat das Clubnetz in Dresden gezeigt. Da sind 15 Clubs aus allen Sparten vereint. Wir als Jazzclub gehören ebenso dazu wie die größeren Rock/Pop-Liveclubs bis hin zu den Techno-Clubs. Das Geld, das da über Spenden zusammenkam, ist das Einzige, was die Tonne bisher bekommen hat. Uns geht es noch nicht schlecht genug, sodass uns diese ganzen Fördermaßnahmen seitens der Politik im Augenblick noch gar nichts bringen, weil wir sie noch gar nicht beantragen können. Dass wir über diese Aktion Geld bekommen haben, zeigt ja, dass das genau der richtige Weg ist. Wir müssen genreübergreifend arbeiten.
Norbert Oberhaus: Welche Summe habt ihr denn in den vier Wochen in Dresden eingesammelt?
Steffen Wilde: 70.000 Euro. Dieses Ergebnis hat beim Start der Aktion niemand von uns erwartet.
Teil 1: Die Kollateralschäden sind enorm
Teil 3: Stolpersteine