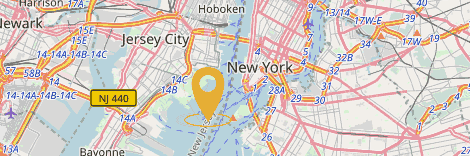New York im tiefen Tal
[7.6.2020]
Das Tal ist noch nicht tief genug. Mittlerweile ist es Juni und mir wird bewusst, wie wenig ich dieses Land verstehe, in dem ich seit mehr als zehn Jahren lebe. Seit gestern Abend gilt eine strikte Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens für ganz New York City. Es ist die erste Ausgangssperre in New York seit dem zweiten Weltkrieg – genauer gesagt: seit 75 Jahren. Helikopter kreisen ohne Unterbrechung, Feuerwerkskörper knallen durch die Straßen, Mülleimer brennen – während tausende Menschen gegen die unsägliche Polizeigewalt an Afroamerikanern protestieren.
Seit Miles Davis 1959 vor dem Birdland Jazzclub von einem weißen Polizisten zusammengeschlagen wurde, hat sich kaum etwas geändert. Der schon damals preisgekrönte Trompeter hatte genau eine Woche (!) nach Veröffentlichung des erfolgreichsten Jazzalbums aller Zeiten, „Kind Of Blue“, ein Engagement in dem berühmten New Yorker Club. Während einer Zigarettenpause vor der Tür wurde Davis von einem Polizisten aufgefordert, sich zu entfernen. Selbst sein Hinweis auf das Konzertplakat des Abends wurde ignoriert, bis ihn schließlich ein Zivildetektiv mit einem Schlagstock zu Boden prügelte. Miles wurde daraufhin verhaftet, musste am Kopf genäht werden und wurde darüber hinaus wegen schwerer Körperverletzung eines Polizisten angeklagt.
„Don’t Call Me Nigger, Whitey!“
Jetzt brachte die brutale Ermordung von George Floyd vor gut einer Woche das Fass zum Überlaufen. Aber schon vorher hat es während der letzten Monate gebrodelt. Die Corona-Krise trifft die afroamerikanische Gesellschaft überdurchschnittlich hart: Im Central Park täuscht eine Frau die Bedrohung durch einen Afroamerikaner vor, der Jogger Ahmaud Arbery wird von zwei weißen Männern gejagt und anschließend erschossen, in Kentucky fällt die Sanitäterin Breonna Taylor Polizeigewalt zum Opfer.
Der Schlagzeuger Obed Calvaire meint, das politische System der USA sei von dieser krassen Ungleichheit betroffen. Insbesondere kritisiert er die Ausbildung der Polizei: „Vor ein paar Jahren war ich auf Tour in Deutschland. Eines Morgens sind wir am Bahnhof und dieser riesige, betrunkene Typ macht Ärger. Vier Polizisten mit Hund sind vor Ort, davon schafft es der kleinste Polizist den Mann mit einem Handgriff in zwei Sekunden zu überwältigen. Ohne Gewalt. Hier hätten die Polizisten wahrscheinlich schon längst geschossen, weil sie nicht genügend ausgebildet sind.“ Weiter erzählt er von einem Auftrag für das SF Jazz Collective im vergangenen Herbst. Bewusst habe er den Song „Don’t Call Me Nigger, Whitey!“ von Sly & The Family Stone arrangiert. Die Aussage sei nach wie vor aktuell.
Turbulente Zeiten
All dies passiert vor dem Hintergrund der Corona-Krise. New York ist noch immer Hotspot, Musiker, egal, ob Top-Stars oder Studierende, haben weder Aufträge noch Konzerte. Ich frage meinen ehemaligen Lehrer, dem Saxofonisten Joe Lovano, wie er die Krise erlebt. Obwohl all seine Tourneen dieses Jahr abgesagt wurden, kann er auch Positives erkennen: „Es gab viele einschneidende Momente in der Menscheitsgeschichte und genau so einen Moment erleben wir jetzt. Während der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er-Jahren oder während des Zweiten Weltkriegs ist prägende Musik entstanden. In den 1940er-Jahren herrschte zum Beispiel ein jahrelanges Aufnahmeverbot. Genau in dieser Zeit haben Charlie Parker, Dizzy und Thelonious Monk eine neue Musikform entwickelt. Später hat man das dann Bebop genannt.“
An die jüngere Generation hat Lovano große Erwartungen: „Ich hoffe, dass gerade viel Soul-Searching stattfindet, das zu mehr Ehrlichkeit bei den Musikern führt. Nicht das ewige Kopieren der Geschichte eines Anderen. Du lebst deine eigene Geschichte – jetzt hast du etwas zu sagen! Es kann nicht alles nur ein kommerzielles Unterfangen sein, sondern es muss tiefer und kreativer gehen.“ Außerdem hat er wieder Zeit, seine Plattensammlung neu zu entdecken. Seine Empfehlungen: Keith Jarretts „Survivors Suite“ (ECM, 1977) und Archie Shepps „Steam“ (enja, 1976).
Diesen positiven Spirit spürt man auch auf den Straßen. Die Menschen rücken näher zusammen und der sonst übliche Small-Talk wird nun oft zu einem längeren Gespräch. Der Fahrradkurier schenkt einem Obdachlosen nicht abgeholtes Essen, die Joe’s Pizzeria liefert jeden Tag hunderte kostenlose Pizzen an umliegende Krankenhäuser, Laufclubs drehen keine Runden in den Parks, sondern machen Erledigungen für Hochrisiko-Patienten.
Nehmt euch Zeit
Für Trompeterin Ingrid Jensen ist das Positive die gewonnene Zeit mit ihrer Familie. „Mein Leben war ein pausenloses Packen und Auspacken von Koffern, das Vermissen meiner Familie ein ständiger Begleiter. Jetzt bin ich den ganzen Tag zu Hause und ich liebe es!“ Ein normaler Tag in Corona-Zeiten sieht für sie so aus: „Morgens bekomme ich täglich Bewegung, dank vieler Spaziergänge mit unserem neuen Familienhund, Donny – hier in unserer Westchester-Gegend (Vorort nördlich von New York). Anschließend stehen Unterrichten via Zoom, Online-Meetings und Büroarbeit auf dem Programm. Unsere Tochter besucht die dritte Klasse – online natürlich – und ihr Vater hilft ihr hauptsächlich bei den Hausaufgaben. In dieser Zeit kann ich komponieren und üben, kombiniert mit Wäsche und Hausarbeit, die niemals zu enden scheint. Um 19 Uhr spiele ich entweder aus dem Fenster oder setze mich in den Vorgarten. Mein Mann Jon sitzt am Schlagzeug und dann spielen wir für unsere Nachbarn zwischen 10 und 30 Minuten. Dieses soziale Experiment begann als Gruß an die Frontlinien-Arbeiter und ist dank unserer engagierten Zuhörer, die bei Regen oder Sonnenschein erscheinen, zu einem viel größeren Ereignis geworden.“ Auch Jensen schlägt ähnliche Töne an wie Lovano: „Nehmt euch Zeit! Nutzt diesen historischen Moment als Pause, um tief zu reflektieren und unterhaltet euch enger mit Familie und Freunden.“
It’s like my meditation
Für Bassist Matt Penman sieht der Alltag anders aus. New York hat für dieses Schuljahr keine Öffnungen in Aussicht gestellt und seine Frau arbeitet Vollzeit. Deshalb ist er für die Kinderbetreuung zuständig: „Plötzlich bin ich kein professioneller Musiker mehr, sondern Grundschullehrer. Ich bin arbeitslos, aber nie hatte ich weniger Zeit …“ Trotzdem versucht Penman, jeden Tag etwas Zeit an seinem Instrument zu verbringen: „It’s like my meditation.“
Ein Resultat dieser Krise sieht er schon jetzt: „Vergessen wir nicht, dass es so etwas schon gegeben hat. Nicht während unseres Lebens und nicht so global, aber auch jetzt werden wir es überstehen. Aber im Moment trauere ich um den Verlust einer eingeschworenen Band, die zusammen mit einem aufmerksamen Publikum vibriert, das an jeder Note hängt – den Schweiß zu sehen und das Holz und das Metall zu fühlen. Ich denke, wir Musiker werden unseren Job nie wieder für selbstverständlich halten.“
Tempo verlangsamen
Auch die Sängerin Sara Serpa verbringt viel Zeit mit dem sogenannten Home-Schooling ihres sechsjährigen Sohnes. Zusammen mit ihrem Mann, dem Gitarristen André Matos, lebt sie in einem Apartment in Harlem. Wenn dazwischen Zeit bleibt, versucht Serpa, viel im Park, in der Natur zu sein: „Mein Tempo zu verlangsamen, bedeutete, meine Prioritäten neu zu definieren. Ich verarbeite noch. Jeden Tag lese ich die Nachrichten und fühle mich deprimiert. Die Erkenntnis, wie Milliardäre von dieser Krise profitieren, hat meine Art, Dinge zu konsumieren, verändert: Essen, Musik, Film, Bildung. Es hat meine Aufmerksamkeit noch mehr auf die Natur gelenkt und mich jeden Moment im Freien genießen lassen. Ich habe keine Lust mehr auf Computer, Zoom usw.“
Für Obed Calvaire gibt es trotzdem positive Aspekte. Der Schlagzeuger kehrte gerade noch kurz vor Schließung der Grenzen von einer Tour mit Wynton Marsalis zurück und ist seitdem zu Hause in Jersey City. „Puh, da hatten wir Glück! Generell sehe ich das Glas eher halbvoll. Ich habe einen fünf Monate alten Sohn und kann jetzt viel Zeit mit ihm verbringen. Als tourender Musiker vermisst man das oft. Die andere positive Seite: Du kannst dich auf dein Handwerk besinnen! Diese Periode nutze ich intensiv, um an Mängeln in meinem Spiel zu arbeiten – so viele Gewohnheiten, die sich über die Jahre eingeschlichen haben. Seit dem College hatte ich nicht mehr so viel Zeit zum Üben. Außerdem schreibe ich gerade Musik für mein erstes Album als Leader.“ Aber auch ihm fehlt das Live-Erlebnis, das durch kein Streaming zu ersetzen sei: „Jazz ist eine so emotionale Musik. Was ich morgens zum Frühstück hatte, die Diskussion mit meiner Frau: All das beeinflusst mein Spiel am Abend. Und als Zuhörer gehen dir diese Emotionen verloren, wenn du es nicht live erlebst.“
Nach dem Sturm
Jemand, der die Musikindustrie bis ins Detail kennt, ist Jazzpromoter Chris DiGirolamo. Er arbeitete unter anderem mit den „Grammy“-Gewinnern Steve Gadd, Ellis Marsalis und Dafnis Prieto. Auf die Frage, wie er die Zukunft des Jazz nach dieser Krise sieht, antwortet er: „Ich weiß, ich bin in der Minderheit, aber wenn der Sturm vorbei ist, werden wir die andere Seite sehen. Jazz ist seit wie vielen Jahren tot? Ich wünschte, ich könnte so tot sein (lacht). Erzähl das den Schlangen, die vor den Jazzclubs in ganz NYC anstehen. Veränderungen kommen und gehen, Musik kommt und geht, diese Herausforderungen sind gekommen und auch sie werden gehen. Ich sehe viele kreative und positive Veränderungen, die eintreten werden. Es gibt immer Dunkelheit und manchmal Angst, bevor man das Licht sieht. Dem Jazz wird es gut gehen, wir müssen uns nur ein paarmal abstauben und das Gute sehen.“
Eines Abends bin ich wieder mit dem Fahrrad auf den leeren Straßen von Manhattan unterwegs. Da höre ich aus der Ferne ein Saxofon. Was ist das? Ich folge den Klängen immer weiter in Richtung Times Square. Dort sehe ich an einer Ecke den Straßenmusiker Sweet Lou sitzen, gerade spielt er Charlie Parkers „Confirmation“. Ich unterhalte mich kurz mit ihm und erkundige mich, was ihn dazu bewegt hat, hier alleine zu spielen: „Ich musste einfach raus mit meinem Horn. Normalerweise komme ich jeden Tag hierher, um zu spielen. Das ist mein Leben.“ Ich höre ihm noch eine Weile zu, dann muss ich los. Auf dem Heimweg begleitet mich sein bluesiger Sound noch über viele Straßenzüge hinweg.
(Alle hier erwähnten Interviews werden demnächst auf der Facebook Seite von Jazz thing per Video veröffentlicht.)
Mariana Meraz ist Fotografin, die in Brooklyn, New York, und Berlin lebt. Mit dem Foto-Essay-Buch „19 Times“ fängt sie in eindrucksvollen Bildern die Atmosphäre während der Corona-Pandemie in New York ein. Merez‘ Buch ist am 27. Mai im Kerschensteiner Verlag erschienen.